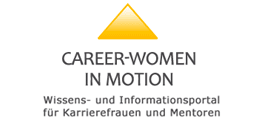Die Rolle des Mannes ändert sich seit Jahren vom patriarchalischen Haupternährer der Familie hin zum fürsorglichen Papa mit flexiblen Karriereoptionen. Doch für viele Männer ist das ein Dilemma – auch an Hochschulen. von Mareike Knoke
Dr. Matthias Klatt ist Vater dreier Töchter. Und er ist sehr stolz darauf. Wer den Lebenslauf des 37-jährigen Juristen und Juniorprofessors an der Universität Hamburg im Internet anklickt, findet darin die Namen und Geburtsdaten der drei kleinen Mädchen. An seinem Lehrstuhl allerdings wurde das Thema „Familie“ bislang vor allem von seinen männlichen Kollegen nie thematisiert. Weder während des Berufungsgespräches, das ihn von Oxford nach Hamburg führte, noch danach, erinnert sich Klatt. Er selbst dagegen würde sich gerne noch mehr als Vater einbringen und bedauert: „Ich habe manchmal das Gefühl, dass vor allem Männer in der Wissenschaft als Menschen ohne Unterleib betrachtet werden, die sich 24 Stunden am Tag der Arbeit widmen.“
Klatt befindet sich mitten in der wissenschaftlichen Qualifizierungsphase, der nächste Schritt auf der Karriereleiter ist die unbefristete Professur. „Der Druck, regelmäßig zu publizieren, ist groß, die Zwischenevaluation steht bald an. Deshalb kann ich im Augenblick leider keine Elternzeit nehmen“, sagt er. Statt dessen hat seine Frau, Psychologin und ebenfalls Wissenschaftlerin, ihr berufliches Engagement reduziert.
„Ich habe das Gefühl, dass Männer in
der Wissenschaft als Menschen ohne
Unterleib betrachtet werden.“
Chefs sind selten „neue“ Männer
Dabei entspricht Matthias Klatt genau dem Rollenbild, das Sozialwissenschaftler als „moderner, neuer Mann“ mit dem Wunsch nach einer gleichberechtigten Partnerschaft bezeichnen. Nur dass dies bei den sogenannten Leistungsträgern an Universitäten offenbar oft ebenso wenig zur Entfaltung kommen kann wie im gehobenen Management eines DAX-Unternehmens. Das zeigen die Interviews mit Wissenschaftler-Vätern unterschiedlicher Altersgruppen und Fachrichtungen, die der Trierer Sozialwissenschaftler Prof. Dr. Günther Vedder und seine Kollegin Prof. Dr. Julia Reuter geführt und vor zwei Jahren unter dem Titel „Professor mit Kind“ veröffentlicht haben. Übrigens die erste und bislang einzige Studie dieser Art. „Sich mit ihrer Rolle als Mann und Vater im Arbeitsalltag auseinander zu setzen und diese Gedanken gegenüber einer anderen Person zu artikulieren, war für unsere Gesprächspartner eine vollkommen neue Erfahrung“, sagt Julia Reuter rückblickend.
Wissenschaftler sind oft wie Mönche
Dass nie jemand danach gefragt hat, wundert Dr. Peter Döge nicht. Der Berliner Politikwissenschaftler, der sich am Institut für anwendungsorientierte Innovations- und Zukunftsforschung e. V. mit Chancengleichheit und Work-Life-Balance beschäftigt, sagt: „Der deutschen Wissenschaft merkt man immer noch an, dass sie ihre Wurzeln in der zölibatären Gemeinschaft von Mönchen hat, die sich in ihren Klöstern vergraben, ohne Ablenkung dem Forschen und Schreiben gewidmet haben.“ Trotz der viel gepriesenen Flexibilität des Uni-Arbeitsalltags sei der Karrieredruck heute immens. Döge bietet regelmäßig Väter-Seminare an, in denen Männer sich auch untereinander austauschen können, und seiner Beobachtung nach sind es vor allem strukturkonservative Fächer wie Medizin oder Jura, die den Männern die Wahl „publish or perish“ (veröffentliche oder stirb) beziehungsweise „publish or parents“ (veröffentlichen oder Eltern sein) und damit indirekt auch ein Beibehalten der traditionellen Männerrolle aufzwingen.
„Es geht
ein Riss durch
die Männerwelt.“
Das bringt junge Wissenschaftler wie Matthias Klatt in eine Zwickmühle: zwischen dem, was sie selbst als Lebensentwurf angeben – eine gleichberechtigte Partnerschaft und die Sehnsucht nach einer ausgeglichenen Work-Life-Balance – und dem, was die Realität des Alltags in Gestalt der Vorgesetzten, der Gesellschaft, der Medien ihnen vorgeben. Vorzugsweise in den sogenannten Lifestyle-Magazinen nämlich und in den Köpfen vieler Chefs herrscht immer noch das Bild des starken, maskulinen und beruflich erfolgreichen und karriereorientierten Machers vor. Die Versuchung, dieser Vorstellung gerade im Job und unter Druck nachzugeben, ist groß und wird oft von schlechtem Gewissen begleitet. „Es geht ein Riss durch die Männerwelt. Ein tiefer zeitdiagnostischer Graben spaltet die Gruppe jener, die ein sehr modernes Selbstbild haben, von jenen, die an ihren eigenen überkommenden Routinen schleifen“, sagt der Soziologe Dr. Carsten Wippermann vom Forschungsinstitut Sinus Sociovision in Heidelberg. Dabei sehen Männer Männer heute anders als noch die Generation zuvor. So finden sich unter den Top Ten der Eigenschaften, die Männer an ihren Geschlechtsgenossen sympathisch finden, weiche, gemeinhin Frauen zugeschriebene Persönlichkeitsmerkmale wie „liebevolle Fürsorge für die Kinder“, „sexuelle Treue“, „Konflikte schlichten“ oder „die Familie gut versorgen“.
Nicht scharf auf neue Männer?
Das hat Wippermann in seiner Studie „Männer: Rolle vorwärts – Rolle rückwärts“ von 2009 herausgefunden. Berichte von Neuro-Wissenschaftlern dagegen, wonach Männer erst nach der Gabe von Hormonsprays ähnliche Empathie-Werte wie Frauen erreichen, wie sie kürzlich von deutschen und britischen Forschern im Journal of Neuroscience veröffentlicht wurden, tragen eher dazu bei, klischeehafte Rollenbilder weiter zu zementieren.
Für zusätzliche Irritation sorgt der Verdacht, dass Frauen vielleicht gar nicht so scharf auf den „neuen Mann“ sind, wenn sie in Lifestyle-Magazinen bekennen, sie wünschten sich lieber einen toughen Kerl als einen weichgespülten Müsli-Mann an ihrer Seite. Gleichzeitig tun sich Frauen trotz des Wunsches, sich auch beruflich zu verwirklichen, schwer damit, Verantwortung für die Kinderbetreuung abzugeben und damit ihre Macht über das Haushaltsmanagement zu teilen.
Das hat unter anderem die Sozialwissenschaftlerin und Gleichgestellungsbeauftragte Dr. Sybille Jung an der Universität des Saarlandes in einer Umfrage herausgefunden. Etwa 70 Prozent der von Jung befragten männlichen Uni-Angehörigen erklärten, ihre Partnerin würde ihnen nicht zutrauen, die Kinder ebenso gut zu betreuen wie sie selbst. Und laut einer forsa-Umfrage von 2009 würde es 28 Prozent der Frauen stören, wenn sie deutlich mehr verdienten als ihr Mann. Bei den Männern dagegen hätten nur zehn Prozent ein Problem damit, wenn ihre Partnerin die Besserverdienerin ist. Tatsächlich sind immer mehr Frauen in Familien die Hauptverdiener. In den letzten 15 Jahren stieg ihr Anteil von sieben auf elf Prozent an, und jeder fünfte Vater nahm im vergangenen Jahr Partnermonate beim Elterngeld, darunter viele Männer mit Führungspositionen. Das zeigt der Familienreport 2010, den Bundesfamilienministerin Kristina Schröder (CDU) Anfang Juni vorstellte. Dieser Trend hat seine Wurzeln in den 1990er Jahren. Seither fordern die Medien, die Politik und die Öffentlichkeit Männer „zur Veränderung ihres Selbstbildes und ihres Verhaltens im Alltag auf“, schreibt Carsten Wippermann. Er und seine Co-Autoren haben für ihre Studie Männer unterschiedlicher Milieus befragt und unterteilen diese grob in vier Gruppen:
* der traditionell orientierte „starke Haupternährer der Familie“,
* der „postmoderne, flexible Mann“,
* der „moderne Lifestyle-Macho“,
* der „moderne, neue Mann“.
32 Prozent der befragten Männer stufen sich selbst als „moderne, neue Männer“ ein, 23 Prozent rechnen sich den „starken Haupternährern“ zu, 31 Prozent den „flexiblen Postmodernen“, die aus der Situation heraus entscheiden und sich auf nichts Konkretes festlegen wollen, und nur 14 Prozent zählen sich zu den „Lifestyle-Machos“, die einen „von weiblicher Unterordnung geprägten, selbstbewussten Chauvinismus“ leben.
Männlicher Umgang mit Gefühlen
Auch das Wissenschaftler-Team Prof. Dr. Paul Zulehner und Dr. Rainer Volz hat in seiner über 400 Seiten dicken Untersuchung „Männer in Bewegung: Zehn Jahre Män-nerentwicklung in Deutschland“ ähnliche Typologien destilliert. Zulehner und Volz befragten 1470 Männer und 970 Frauen. Sie rechnen jedoch, anders als Wippermann, nur 19 Prozent zu den „neuen Männern“. Der Unterschied liegt zwischen Behauptung und Realität: Zulehner und Volz haben jene Männer erfasst, die ihr modernes Rollenbild auch tatsächlich leben. Das sind beim „modernen Mann“ magere zwei Prozent mehr als bei der letzten Befragung von 1998.
Neben Wippermann und Zulehner haben andere Forscher sich des Themas Mann angenommen. Im Februar etwa fand in Düsseldorf ein Männer-Kongress unter der Fragestellung: „Neue Männer – muss das sein?“ statt, der sich mit dem „männlichen Umgang mit Gefühlen“ beschäftigte. Eines zeigt sich bei fast allen Untersuchungen deutlich: Ans Eingemachte geht es bei Fremd- und Selbstbildern von Männern vor allem dann, wenn das Thema Partnerschaft, Kinder und Karriere ins Spiel kommt.
Männer haben Angst ums Standing
Das ist in der Wissenschaft nicht anders als in der Wirtschaft. So erforscht etwa Prof. Dr. Michael Meuser von der TU Dortmund das Thema Doppelkarriere-Paare in der Wissenschaft. Zudem war Meuser an einer Studie des Instituts für Forschungsinformation und Qualitätssicherung (IFQ) über Emmy-Noether-Nachwuchsgruppenleiter beteiligt, die auch die Work-Life-Balance junger Forscher untersuchte. Sein Fazit: „Fast immer sind es die Frauen, die letztlich eine Lösung für das Dilemma Kind-Karriere finden und Kompromisse machen.“ Die Männer dagegen äußerten oft die Befürchtung, ihr „Standing“ an der Hochschule oder am Institut sei noch nicht stark genug, um Forderungen nach Vereinbarkeit von Karriere und Familie zu stellen. „Den Männern schlägt in so einem Fall vielerorts Zweifel an ihren Karrierorientierung entgegen“, sagt Meuser.
Schärfer formuliert es der Berliner Politologe und Privatdozent Dr. Alex Demirovic: „Die Elternschaft wird von kinderlosen, oftmals jüngeren Kollegen ironisch belächelt. Damit hat man sich für Windeln und Babysprache entschieden. Für wirklich ernsthafte wissenschaftliche Gespräche scheint man sich damit disqualifiziert zu haben.“ Männer, die sich nach Feierabend als Elternsprecher in Kita oder Schule engagieren, haben keine Lobby und sich selbst in den Augen von Kollegen auch für das disqualifiziert, was Demirovic die „Männerbünde und -netzwerke in der Wissenschaft“ nennt. Zwar gehe es dort natürlich auch um die Pflege von Freundschaften. „Doch letztlich entscheidet die Zugehörigkeit zu solchen Netzwerken auch über den Erfolg von Förderanträgen und somit über die berufliche Karriere.
Mareike Knoke ist duz-Redakteurin (Unabhängige Deutsche Universitätszeitung). Der Artikel ist in der duz 07/2010 erschienen.