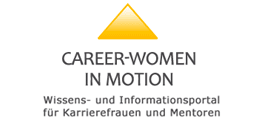Die von Thilo Sarrazin erneut angefachte Diskussion zeigt eines: Menschen unterschiedlicher Religion in eine Mehrheitsgesellschaft zu integrieren ist keine Aufgabe, für die es einfache Lösungen gibt. Das gilt ganz besonders für Europa, wo anders als in den USA, Kanada oder Australien Religion etwas mit Geografie zu tun hat. Von Prof. Dr. Thomas Straubhaar
„Cuius regio, eius religio“ ist der in vielen Kriegen blutig erkämpfte Kompromiss, der europäisches Denken prägt. Entsprechend gibt es in Europa Staatskirchen mit ihrem dominanten Einfluss auf das religiöse Leben der ganzen gebietsansässigen Bevölkerung, unabhängig davon, ob einzelne Menschen dem Glauben angehören oder nicht.
In den USA oder Kanada spielt die Religionszugehörigkeit dagegen schlicht keine Rolle, weil die Trennung von Kirche und Staat strikt durchgesetzt ist. Der 1. Zusatzartikel zur amerikanischen Verfassung schreibt
nicht nur die Religionsfreiheit fest. Er verbietet es dem Staat, Kirchen zu etablieren oder einzelne Religionen speziell zu fördern. Das geht so weit, dass es keine amtlich geschützten religiös begründeten Feiertage gibt und Weihnachten, Ostern oder Pfingsten zu feiern als reine Privatsache betrachtet wird.
Entsprechend der Verbannung von Religion ins Private spielt die Religionszugehörigkeit auch bei Bewerbungsverfahren keine Rolle, zumindest offiziell. Das gilt ganz explizit auch bei der Zuwanderung. Würde jemand versuchen, Religion oder Ethnien zu bewerten, gäbe das einen Proteststurm. Weder beim kanadischen Punktesystem noch bei dem amerikanischen Immigrationsprozess ist die Religionszugehörigkeit ein Kriterium, entscheidend sind Qualifikation, Sprachkenntnisse, Berufserfahrung und Lebensalter. Das gilt im Übrigen auch nach dem 11. September, wobei die alltägliche Praxis auch anders aussehen kann als die religionsblinde Theorie.
Obwohl die Integration von Andersgläubigen in christlich geprägte europäische Gesellschaften nicht spannungsfrei sein kann, zeigen empirische Studien für Deutschland ein verblüffendes Ergebnis: Im europäischen Vergleich ist Integration hierzulande keineswegs gescheitert, sondern in vielen Bereichen durchaus zufriedenstellend oder sogar gelungen. Beide Seiten, Menschen mit und ohne Migrationshintergrund, bewältigen die durchaus nicht einfachen Herausforderungen pragmatisch und zuversichtlich. Es gibt weder Grund für Polemik noch für Populismus. In der konkreten Alltagswirklichkeit des multireligiösen Zusammenlebens in Deutschland wirken sie anachronistisch, wie verstaubte Schlagzeilen von vorgestern.
Die ökonomischen und sozialen Folgen von Zuwanderung lassen sich seriös nur schwer abschätzen. Man „ruft Arbeitskräfte, und es kommen Menschen“, wie es Max Frisch bezeichnet hat, mit all ihren persönlichen Merkmalen und Eigenschaften. Das ist der entscheidende Unterschied zum Güterhandel oder zu internationalen Kapitalbewegungen. Nahezu alle empirischen Studien zeigen jedoch übereinstimmend, dass die makroökonomischen Effekte in der Summe bescheiden bleiben. Das gilt sowohl für die positiven Beschäftigungs- und Wachstumseffekte wie auch für die mit der Integration einhergehenden Anpassungskosten.
Deshalb tun sich die Befürworter einer liberalen Politik auch so schwer, wenn sie die Vorteile herausstreichen wollen, und deshalb schießen die Gegner mit polemischen Verallgemeinerungen einzelner Kosten so weit übers Ziel hinaus. Klüger ist es, von beiden Seiten her die Erwartungen herunterzuschrauben und eine Migrations- und Integrationspolitik der Bescheidenheit zu verfolgen. Gestaltbarkeit, Steuerbarkeit und Machbarkeit sind äußerst begrenzt. Einfache allgemeine Regeln wie beispielsweise ein Punktesystem mit ganz wenigen Kriterien (Alter, Sprache, Qualifikation) sind zweckmäßiger als eine Politik, die von Zuwanderung zu viel erwartet. Mit Bescheidenheit und dem Verzicht auf große Würfe vermeidet man am ehesten Fehlsteuerungen und unbeabsichtigte Nebenwirkungen.
Aus den Erfahrungen der klassischen Einwanderungsländer kann die neue Einwanderungsgesellschaft Deutschland die Lehre ziehen, dass mehr Toleranz die Integrationsanstrengungen erleichtert. „Glauben und (nicht) glauben lassen“ ist ein Motto, das nicht zuletzt auch dem steigenden Anteil religionsferner Bevölkerungsteile entgegenkommt. Religiöse Neutralität hat nichts mit dem Untergang des christlichen Abendlandes zu tun, im Gegenteil. Sie ist eine Notwendigkeit für eine Gesellschaft, in der es um persönlichen Glauben, nicht um das Festhalten an einzelnen Religionen geht.
An der Lebendigkeit des multireligiös praktizierten Glaubens in den USA lässt sich leicht erkennen, dass auch in Glaubensfragen Wettbewerb nicht schadet, sondern beflügelt.
Wenn das eigene Christentum eher als historische Verklärung vergangener Zeiten und in defensiver Mentalität als Ausgrenzung anderer daherkommt, ist das zu wenig. Eine selbstbewusste Herangehensweise ist überzeugender. Sie traut dem Christentum so viel zu, dass es nicht gegen, sondern neben anderen Religionen steht und so die Attraktivität und Stärke eines durch Individualität und Vernunft selbstbestimmten Denkens und Lebens offenbaren kann. Dann wird es zur alltäglichen Nebensache, ob jetzt der Sabbat am Freitag für die Muslime, am Samstag für die Juden oder am Sonntag für die Christen gefeiert wird. Genauso unwichtig wird dann, inwieweit Menschen ihreGesichter durch Tücher, Schleier oder andere Bedeckungen verhüllen wollen. Ob Kirchen, Moscheen oder Tempel gebaut werden dürfen oder nicht, ist eine Frage des Baurechts und der Lärmverordnungen und nicht mehr Zankapfel der Bewertung religiösen Verhaltens.