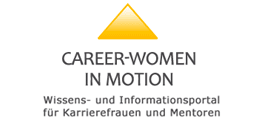Es war nur ein Satz, dieser aber mit weitreichenden Folgen. Das Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg hat mit Urteil vom 28.06.2011 (AZ: 3 Sa 917/11) entschieden, dass die arbeitgeberseitige Äußerung gegenüber einer Arbeitnehmerin, die im Gegensatz zu ihrem (männlichen) Kollegen nicht befördert wurde, „sie solle sich doch auf ihr Kind freuen“, eine Vermutung der Benachteiligung wegen des Geschlechts darstelle.
Dies auch vor allem deshalb, da der schwangeren Arbeitnehmerin trotz ihrer Nachfrage keine konkreten Gründe für die Beförderung des Kollegen genannt werden konnten, obwohl ihrer Bewerbung zuvor Chancen eingeräumt worden waren. Da der Arbeitgeber diese Vermutung nicht widerlegen konnte ist das LAG von einer geschlechtsspezifischen Benachteiligung ausgegangen und hat den Arbeitgeber zu 17.000 Euro Schadensersatz wegen Diskriminierung verurteilt.
Die Arbeitnehmerin war im Bereich „International Marketing“ eines Konzerns als eine von drei Abteilungsleitern beschäftigt. Im September 2005 wurde die Stelle des Vorgesetzten frei. Die Arbeitgeberin besetzte diese mit einem Mann und nicht mit der damals schwangeren Klägerin.
Diese begehrte daraufhin die Zahlung einer Entschädigung wegen Benachteiligung aufgrund ihres Geschlechts, weil sie die Stelle wegen ihrer Schwangerschaft nicht erhalten habe. Die Arbeitgeberin behauptete, für die getroffene Auswahl sprächen sachliche Gründe.
Das Landesarbeitsgericht hat in dem jetzigen Grundsatzurteil angenommen, bei einer Gesamtwürdigung aller Umstände spreche eine Vermutung dafür, dass die Arbeitnehmerin wegen ihrer Schwangerschaft nicht befördert worden sei. Dabei wurde u. a. berücksichtigt, dass bei der Ablehnung ihrer Bewerbung seitens der Arbeitgeberin geäußert wurde, „sie solle sich doch auf ihr Kind freuen“. Zudem wurden ihr trotz Nachfrage keine konkreten Gründe für die Beförderung eines Kollegen genannt, obwohl ihrer Bewerbung zuvor Chancen eingeräumt worden waren. Die Vermutung konnte die Beklagte nicht widerlegen. Es war daher von einer geschlechtsspezifischen Benachteiligung auszugehen.
Diese Entscheidung zugunsten der Arbeitnehmerin fiel aber erst nach fünf Jahren und 8 Prozessen.
Das Landesarbeitsgericht in Berlin-Brandenburg hatte zweimal zuvor den Anspruch der Klägerin abgelehnt, bis dann das Bundesarbeitsgericht die Reißleine zog und den Prozess an eine andere Kammer des Landesarbeitsgerichts verwies. Das BAG hatte in den Vorprozessen zum Ausdruck gebracht, das Verhalten des Arbeitgebers spreche sehr wohl für eine Diskriminierung.
Bei Verdacht Mobbing-Tagebuch führen
Diskriminierungsklagen sind meist reine Indizienprozesse. Denn was sich tatsächlich hinter einer Personalentscheidung des Arbeitgebers verbirgt, kann der Arbeitnehmer fast nie beweisen. Deshalb muss er laut Gesetz Hinweise sammeln, die eine Benachteiligung vermuten lassen. Obwohl das Bundesarbeitsgericht augenscheinlich die Anforderungen an den Nachweis von Diskriminierungen senken wollte, ist den Arbeitnehmern zu empfehlen, ein sog. Mobbing -Tagebuch zu führen, in dem die einzelnen Handlungen oder Maßnahmen, aus denen sich die gerügten Pflichtverletzungen herleiten, konkret unter Angabe deren zeitlicher Lage zu bezeichnen sind. Der Arbeitgeber muss dann wiederum belegen, dass seine Entscheidung sachlich gerechtfertigt war.
Das LAG hat die Revision gegen das Urteil nicht zugelassen.